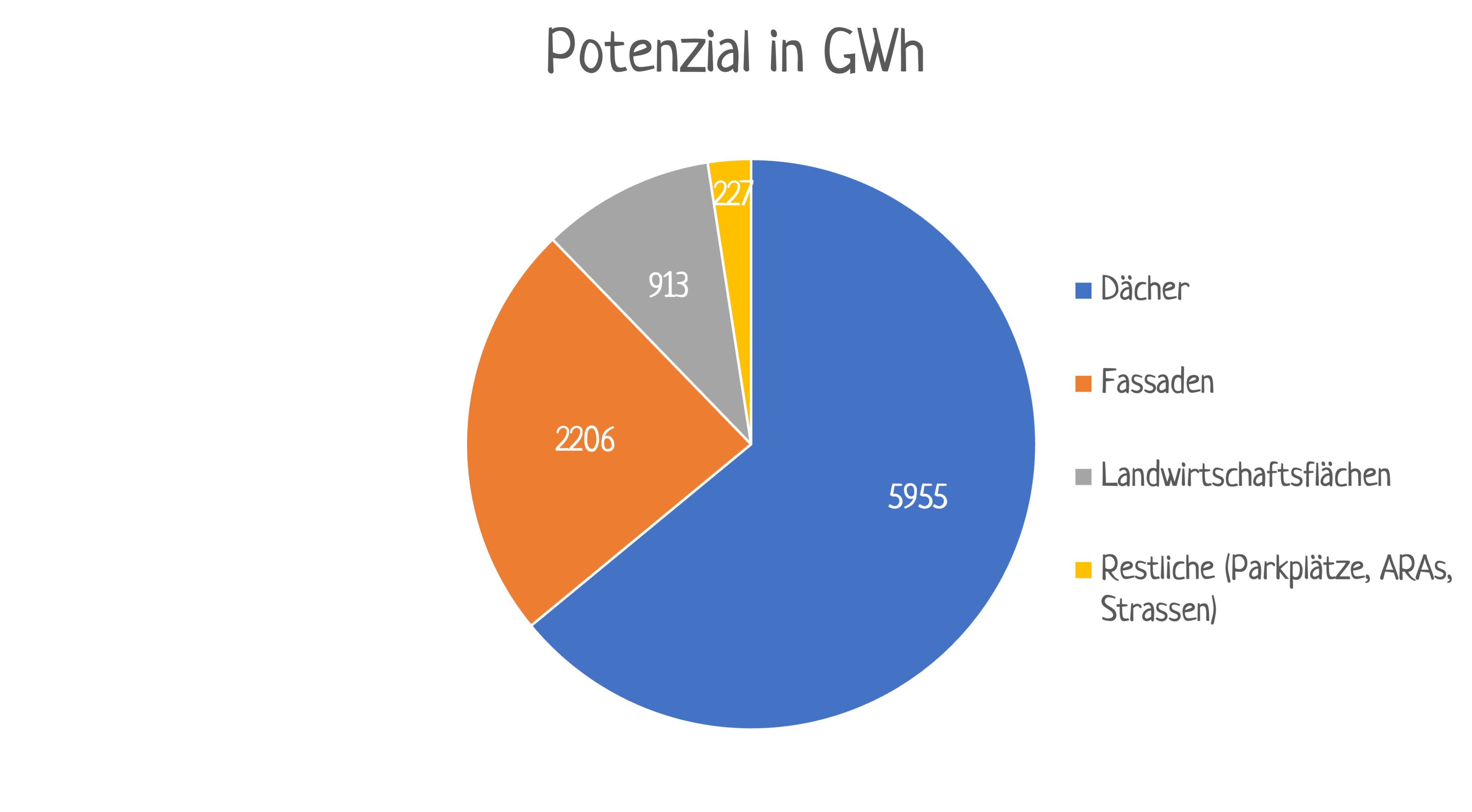In den letzten drei Jahren hat sich der Ausbau von Photovoltaikanlagen in den Zürcher Gemeinden rasant entwickelt. Einige Gemeinden konnten schneller zubauen, andere Gemeinden hatten aber auch weniger passende Projekte. In diesem Blog-Beitrag werfen wir nun einen Blick auf die beeindruckendsten Zahlen und Entwicklungen in Bezug auf Flächenzuwächse und Ausnützungsziffern.
Als Basis für unsere Analysen verwenden wir jeweils immer die Pronovo gemeldeten Daten. Dabei gibt es auch immer wieder Verspätungen der Meldung aber auch Meldefehler. Es kann folglich sein, dass die Zahlen unten nicht immer dem heutigen Stand entsprechen sondern bis zu einem dreiviertel Jahr verspätet sind. Um eine greifbare Zahl zu erhalten rechnen wir die gemeldeten kWpeak um in ein Flächenäquivalent. Je nach installierter technischen Lösung kann dies natürlich auch varieren, macht aber erst einen verständlichen Vergleich zwischen den Gemeinden möglich.
Verhältnismässig den grössten Zuwachs innerhalb der 3 Jahre der Kampagne
Betrachtet man den prozentualen Zuwachs an Photovoltaik-Fläche, stechen einige Gemeinden besonders hervor:
- Ellikon an der Thur führt die Liste mit einem bemerkenswerten Anstieg von rund 834%. Das bedeutet einen Zuwachs von etwa 7300 Quadratmetern an Photovoltaik-Fläche.
- Oberglatt folgt mit einem Zuwachs von etwa 514%, was rund 20500 Quadratmeter zusätzlichen Photovoltaik-Flächen entspricht.
- Weiach verzeichnet einen Zuwachs von etwa 434%, was einer zusätzlichen Fläche von rund 4100 Quadratmetern entspricht.
Diese beeindruckenden prozentualen Zuwächse zeigen das enorme Potenzial und Engagement kleinerer Gemeinden im Bereich der erneuerbaren Energien.
Absolut den grössten Zuwachs
Auch in absoluten Zahlen gab es erhebliche Erweiterungen der Photovoltaik-Flächen:
- Stadt Zürich steht an der Spitze mit einem Zuwachs von ca. 183’000 Quadratmetern mehr als im Jahr 2021.
- Stadt Winterthur folgt dicht darauf mit einem Zuwachs von ca. 144’500 Quadratmetern.
- Illnau-Effretikon belegt den dritten Platz mit einem zusätzlichen Zuwachs von ca. 26’512 Quadratmetern.
Diese Zahlen unterstreichen die bedeutende Rolle der grösseren Städte und Gemeinden im Ausbau erneuerbarer Energien.
Die Musterschüler mit hohen Ausnützungsziffern
Ein weiterer interessanter Aspekt ist die Ausnützungsziffer, die das Verhältnis der genutzten Photovoltaik-Fläche zur verfügbaren Fläche darstellt. Hier stechen drei Gemeinden besonders hervor:
- Knonau mit einer beeindruckenden Ausnützungsziffer von 21.39%.
- Hittnau folgt mit einer Ausnützungsziffer von 12.42%.
- Dielsdorf liegt bei 11.92%.
Diese hohen Ausnützungsziffern zeigen das effiziente und konsequente Engagement dieser Gemeinden im Bereich der Photovoltaik-Nutzung.
Gemeinsame Anstrengungen
Zusammen haben die Zürcher Gemeinden rund 1,6 Millionen Quadratmeter Photovoltaik-Fläche in Betrieb genommen. Diese beeindruckende Gesamtfläche ist ein starkes Zeichen für das kollektive Engagement und den Fortschritt in der Region in Richtung nachhaltiger Energieversorgung.
Die beschriebenen Entwicklungen sind ein eindrucksvoller Beweis dafür, dass sowohl kleine als auch grosse Gemeinden ihren Beitrag zur Energiewende leisten. Die vielfältigen Erfolge in Bezug auf Flächenzuwächse und effiziente Nutzungspotenziale setzen positive Signale für die Zukunft und zeigen, dass die Region Zürich auf einem guten Weg ist, ihre erneuerbaren Energieziele zu erreichen.
Für die Energiewende sind wir dabei aber noch nicht am Ziel. Rund 3 mal mehr Fläche müssen in Betrieb genommen werden um die ambitionierten Ziele zu erreichen. Wenn wir gemeinsam die Zubaugeschwindigkeit aufrecht erhalten können, kommt dieses Ziel aber in greifbare Nähe. Zu unsererm Wohle und dem Wohle unserer Nachkommen.